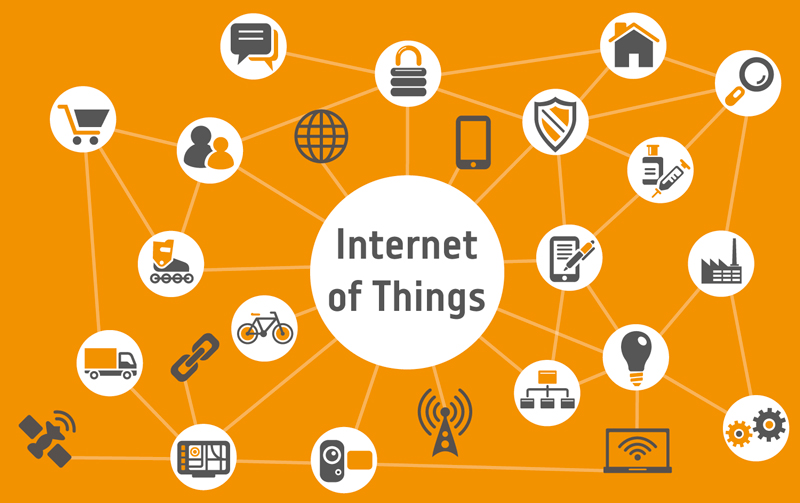Alle Welt schreit „Internet of Things“. Unternehmen brauchen IoT-Strategien, Sensoren überall – niemand kommt heutzutage um dieses Thema herum. Keiner will diesen neuen Zug verpassen und viele geben vor, ohnehin schon vorne dabei zu sein. Kurzum: Es herrscht Goldgräberstimmung. Aber nicht alles, was als IoT Produkt angepriesen wird, ist auch wirklich eine IoT-fähige Lösung.
Der große Nutzen des Internets der Dinge liegt – wie bei der Telekommunikation – in der Möglichkeit, Kommunikationskanäle zwischen allen Beteiligten zu eröffnen: Dabei steigen die Kosten ungefähr linear mit der Anzahl der Teilnehmer, gleichzeitig steigen aber die Kommunikationsmöglichkeiten ungefähr zum Quadrat der Anzahl der Teilnehmer. Dies wurde vor 30 Jahren als „Metcalfe’sches Gesetz“ formuliert.
Das Internet der Dinge bringt nun eine weitere Dimension dazu: Ging es bei der Telekommunikation noch um Informationskanäle von Mensch zu Mensch, dann vervielfacht sich jetzt der Kommunikationsraum, weil wir Maschinen mit der Möglichkeiten ausstatten, etwas über ihre Umgebung herauszufinden und dies an beliebige Informationsabnehmer (die wiederum auch Maschinen sein können) weiterzusenden.
Das Internet der Dinge – Warum jetzt, warum so schnell?
In der Elektronik wurden riesige Fortschritte gemacht, was Energieeffizienz, Verkleinerung und Kostenstruktur von Sensoren betrifft. Ebensolche Fortschritte wurden auf dem Gebiet der Datenfernübertragung gemacht. Daher kann man heute einen Bleistift mit einem Mikrofon ausstatten und Toaster können WLAN-fähig gemacht werden, ohne deshalb wesentlich teurer zu werden. Und nicht zuletzt wurde vor einigen Jahren der Internet Standard Ipv6 eingeführt – mit einer wesentlichen Entwicklung – der enormen Erweiterung des Adressraums: Diese Erweiterung hat zur Folge, dass im Prinzip jeder Quadratmillimeter der Erde mit über 600 Billiarden IP-Adressen versehen werden könnte. Das heißt: Jeder jemals produzierte Bleistift kann seine eigene IP-Adresse haben, ebenso wie jedes Blatt Papier, das jemals beschrieben wurde oder noch beschrieben wird.
Nützliche und unnützliche Anwendungsmöglichkeiten
Was bei Produktstrategen für „feuchte IoT-Träume“ sorgt, ist die Wunschvorstellung von der dauernden und nicht abschaltbaren „Kundenbindung“ im wahrsten Sinne des Wortes „Bindung“: Die Waschmaschine meldet sich zum Service an, weil die Trommel anfängt zu verkalken, der Kühlschrank bestellt frische Milch vom Online-Supermarkt und meine Lebensversicherung wird teurer, weil das Versicherungsprogramm die Daten des Bescheunigungssensors in meinem Auto – wegen eines Bremsmanövers für einen Igel – zu meinen Ungunsten interpretiert hat.
Ganz sicherlich gäbe es auch höchst nützliche Anwendungen: Wenn sich jede Energiesparlampe, die uns mit 10 jähriger Garantie verkauft wurde, selbständig beim Qualitäts-Benchmarker anmelden würde und wenn mir der Produzent im Falle eines frühzeitigen Ablebens der Lampe gleich eine kostenfreie Ersatzlampe schicken würde, dann wäre das eine IoT-Anwendung im Dienste der Nachhaltigkeit. Hier läge der Mehrwert in folgender Synergie: Wir hätten automatische Qualitätsüberprüfung (wieviele Schaltvorgänge? wieviele Betriebsstunden?) und wir hätten automatische Garantieleistung wenn die Mindestanforderungen zum Zeitpunkt des Ausfalls nicht erfüllt wären. Ähnliche Anwendungen im Bereich des Treibstoffverbrauchs bei Autos und der Schadstoffmessungen liegen auf der Hand, haben aber weder bei Politik noch bei Herstellern bislang zu großem Enthusiasmus geführt.
Echte IoT-Lösungen vs. „Feigenblatt“-IoT-Lösungen
Zahlreiche Produkte und Dienstleistungen werden derzeit als IoT-Lösungen erfolgreich vermarktet. Die beiden gängigsten IoT-Modelle sind:
- Sensor + Produkt + Mobilapp = IoT
- Sensor + Produkt + Cloudbased Service = IoT
So gibt es zum Beispiel farbgebende Lampen für die stimmungsvolle Beleuchtung von Innenräumen und man kann per Smartphone App die Farbe kontrollieren. Das ist zwar nett, aber keine echte IoT-Lösung. Denn: Stellen Sie sich mal die Frage, ob Sie die Beleuchtung auch mit dem Beat aus Ihrer Stereo-Anlage kombinieren können. Oder ob Sie wenigstens Farblampen verschiedener Hersteller gleichzeitig regeln können.
Für großflächigere Anwendungen in der Industrie wird vor die Mobile App noch ein sogenanntes Cloud-Service geschaltet. Für den industriellen Anwender stellt sich auch hier die gleiche Frage wie für den Endkonsumenten und seine bunten Glühbirnen: „Kann ich das Cloud-Service des einen Herstellers mit der Cloudlösung des anderen Herstellers verbinden und kann ich mir kombinierte Ergebnisse auf einer Tablet-App ansehen?“.
Als Merksatz für echte IoT-Lösungen gilt die Anwendung des Metcalfe’schen Gesetzes: Der Nutzen kommt nicht von 100 nebeneinander stehenden Apps (die verursachen nur Kosten), sondern von 10 x 10 kommunizierenden Geräten!